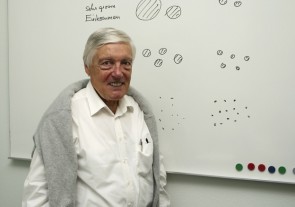28.09.2007, 14:13 Uhr
«Der Informatikberuf ist keine Zirkusnummer»
Die Informatik als Beruf hat in der Schweiz ein gravierendes Imageproblem, so Carl August Zehnder, langjähriger Informatikprofessor an der ETH. Gegenüber Computerworld zeigt er mögliche Wege aus der Nachwuchsmisere auf.
Das Platzen der Internet-Blase, die folgenden Massenentlassungen und das Offshoring von IT-Leistungen ins Ausland haben am Image des Informatikberufs gekratzt. Für viele Interessierte scheint das Tätigungsfeld Informations- und Kommunikationstechnik zu unsicher. Zu unrecht, ist Carl August Zehnder, emeritierter ETH-Professor, überzeugt.
Computerworld: Erklären Sie mir folgendes: Heutige Jugendliche sitzen ständig vor dem PC. Trotzdem wollen so wenige von ihnen professionell in die Informatik einsteigen. Woran fehlt es?
Carl August Zehnder: Das lässt sich einfach erklären. Viele Leute brauchen Elektrizität oder fahren Auto. Trotzdem werden sie nicht Elektroingenieur oder Automechaniker. Informatik ist heute ebenfalls eine Commodity geworden. Sie wird wohl benutzt. Aber das ist noch lange kein Grund, dass jemand auf diesem Gebiet seinen Beruf sucht. Der einzige Unterschied zu den anderen beiden Beispielen ist der, dass es die Informatik erst seit 50 Jahren gibt, dass man also miterleben konnte, wie sie entstanden ist. Das hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung vor allem der älteren Leute. Aber für die heutigen 10- bis 20-Jährigen ist Informatik eine Selbstverständlichkeit.
Wäre es dann nicht ein Leichtes, die Jugendlichen für den Studiengang Informatik zu begeistern?
Aber warum denn? Sie werden doch auch nicht Autokonstrukteur, weil Sie gerne Auto fahren. Besser wäre die Frage: Warum gibt es überhaupt so wenig Ingenieure. Die Antwort ist einfach: Es ist ein schwieriges Studium, bei dem viel Zeit und Mühe in die Erarbeitung der Grundlagen wie Mathematik investiert werden muss. Hier orte ich somit ein gesellschaftliches Problem.
Ich erinnere mich noch: Vor gut zehn Jahren hat man viele Hoffnungen in die Fachhochschulen gelegt. Sie sollten mehr Praxisnähe in die Ausbildung bringen. Wie hat sich das entwickelt?
Durchaus positiv. Die Statistiken zeigen, dass es in der Schweiz bis etwa zum Jahr 2000 nur halb so viele Informatikabschlüsse auf Fachhochschulniveau gab wie auf ETH- und Universitätsstufe. Das hat sich nun grundlegend geändert. Heute schliessen etwa doppelt so viele Informatik-ingenieure ein Fachhochschulstudium ab als eine entsprechende Ausbildung an ETH oder Uni. Und das ist gut so: Denn wir brauchen mehr anwendungsorientierte Informatikingenieure als solche, die mehr -theoretisches Wissen haben. Zudem ist auch die Zahl derjenigen gestiegen, die höhere Fachschulen absolvieren und als Quereinsteiger noch eine höhere Fachprüfung ablegen. Alles in allem also eine positive Entwicklung.
Sie hat nur einen schwerwiegenden Haken. Wenn wir uns die Nachwuchszahlen anschauen, also wie viele junge Leute ein Informatikstudium ? egal auf welcher Stufe ? heute beginnen, dann zeichnet sich Dramatisches ab: Diese Zahl ist beispielsweise bei der Wirtschaftsinformatik an den Unis in fünf Jahren von 185 auf 54 geschrumpft. Bei den klassischen Informatikern an ETH und Uni ist der Rückgang ebenfalls drastisch von 597 auf 246 Studienanfänger. Selbst bei den Fachhochschulen beginnen weniger Studenten ein informationstechnisches Studium. Der Einbruch ist hier weniger drastisch, weil diese Studenten in der Regel eine einschlägige Berufslehre hinter sich haben, also ihr Berufsweg schon vorgespurt ist. Die Hochschulstudenten entscheiden sich dagegen im letzten Jahr vor der Matur für ihre Ausbildung. Hier gibt es also eher hohe jährliche Veränderungen. Auch die Anzahl neuer Lehrverträge ist übrigens rückläufig, dies nach einem eigentlichen Run auf diesen Ausbildungsweg nach der Einführung der Informatikerlehre 1993.
Heisst das, dass diese Ausbildungsgänge zu spät eingerichtet wurden?
Vor Jahrzehnten waren wir in der Schweiz wirklich spät dran. Auch das ETH-Studium Informatik wurde elf Jahre später als etwa in Deutschland eingeführt. Aber mit dem heutigen Einbruch der Anfängerzahlen hat dieses Spät-dran-sein, was leider für das Schweizer Bildungssystem oft bezeichnend ist, nichts zu tun!
Was ist dann das Problem?
Im Moment wird die Informatik in der Öffentlichkeit falsch verstanden. Diese nimmt Informatikberufe als unsicher und unstet wahr.
Wie sicher ist denn der Informatikberuf?
Der ist sehr sicher. Ich bin jetzt 49 Jahre dabei und seit vier Jahren emeritiert. Ich werde aber heute noch angefragt, ob ich nicht Vorlesungen zu bestimmten Themen halten will. Das zeigt doch, dass es in der Informatik Gebiete gibt, die enorm langlebig sind, jedenfalls viel langlebiger als es die Öffentlichkeit vermutet. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man einen Unterschied macht zwischen Produkt- und Konzeptwissen. Während das Produktwissen in der Informatik eine Halbwertszeit von etwa zwei Jahren hat, beträgt diese beim Konzeptwissen 10 bis 15 Jahre. Deshalb muss und kann z.B. die ETH, wo das Studium vier Jahre dauert, hauptsächlich Konzeptwissen vermitteln. Dies ist der Öffentlichkeit nicht bewusst.
Um es zu verdeutlichen: Eltern von Schülern in der Berufswahl vertreten oft die Ansicht, die Informatik sei ein ausserordentlich gefährlicher Beruf, weil sich jedes Jahr alles ändere. Solche Eltern reagieren ähnlich, wie sie vor 100 Jahren reagiert hätten, wenn ihr Kind ihnen eröffnet hätte, es wolle zum Zirkus gehen. Das Problem ist somit: Die Eltern sehen nur die Informatikanwendungen, die sich tatsächlich laufend ändern oder gar obsolet werden, und meinen daher, das ganze Betätigungsfeld sei unseriös.
Reicht das allein aus, um den Beruf des Informatikers in ein so schlechtes Licht zu rücken?
Es gibt weitere Gründe, die dem Image sehr geschadet haben. Ein sehr wichtiger ist die Angst vor Arbeitslosigkeit, und die hat nach der Internetblase bei den Informatikern zugenommen. Aber nur relativ. Sehen Sie, hier habe ich eine Statistik zur Arbeitslosensituation bei frisch diplomierten Hochschulabsolventen in Deutschland in den Jahren 2001 und 2002. Da kommen beispielsweise im Jahr 2001 auf 100 arbeitslose Juristen 50 Stellenangebote, 2002 noch deren 30. Bei den Informatikern aber kommen 2002 immer noch 200 Jobs auf 100 Stellensuchende, während es 2001 deren 600 waren! Für die Informatiker ist das Angebot somit auf einen Drittel zusammengeschrumpft. Das Problem ist nun, dass in der Öffentlichkeit nur dieser Einbruch im Stellenangebot wahrgenommen wird, nicht aber, dass Informatiker weiterhin Hände ringend gesucht werden.
Wie sieht die Arbeitsplatzsituation derzeit aus?
Bedenklich! In der Schweiz müssten wir allein um den Bestand an Informatikern halten zu können, 5000 bis 7000 Leute pro Jahr neu ausbilden, bei einem Totalbestand von weit über 100000 hauptberuflich in der Informatik Tätigen - nicht Informatikanwender, das wären 3 Millionen. Wir bilden aber nicht mal die Hälfte dieser Zahl aus. Dabei haben Informatiker viele Entwicklungschancen, auch in leitenden Positionen in einem Unternehmen. Der Bedarf nach gutausgebildeten Informatikern - und Informatikerinnen! - ist daher sehr gross.
Was passiert also? Die gesuchten Leute werden wenn möglich ins Land geholt. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich habe nichts gegen ausländische Informatiker. Es ist längerfristig einfach schlecht für unsere Volkswirtschaft, wenn wir uns ganz auf den Zustrom von Fachkräften aus dem Ausland verlassen. Wir müssen unsere Hausaufgaben selber machen, speziell in der Ausbildung. Und das bedingt, dass wir unsere Jugend dazu motivieren, auch Ausbildungswege zu beschreiten, die mit einem gewissen Aufwand verbunden sind.
Was für Auswirkungen auf das Image hatte die Diskussion, dass Programmieraufgaben nach Indien und China ausgelagert werden?
Das Outsourcing ist ein weiterer unsachlicher Grund zur Ablehnung einer Informatikausbildung. Denn nur ganz bestimmte Aufgaben eignen sich überhaupt fürs Outsourcing. Es sind dies vor allem jene reinen Programmierarbeiten für den Bau von Applikationen. Die Planung dieser Anwendungen sollte dagegen in jedem Fall hier erfolgen. Schon beim Betrieb der Anwendungen ist ein Outsourcing höchstens zum Teil möglich. Hierher gehört etwa auch der Support: Wir haben gut drei Millionen Bildschirmarbeitsplätze in der Schweiz. Wenn sie für 60 Arbeitsplätze eine Person im Support rechnen, dann ergibt das bereits 50000 Arbeitsplätze, und zwar in der Schweiz. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass es auch in zehn Jahren noch so viele Supporter braucht wie heute, da ja auch hier eine gewisse Automatisierung stattfindet, aber neue Aufgaben kommen dafür dazu.
Was hat dem Ansehen am meisten geschadet?
Der grösste Imageschaden wurde der Informatik durch Nachrichten über massive Entlassungen nach 2002 zugefügt. So wurden von Firmen grosse Zahlen an zu entlassenden Informatikern bekannt gegeben. Dass die selben Unternehmen gleichzeitig fast so viele Informatiker neu einstellten, die besser ausgebildet, jünger und daher billiger waren, wurde dagegen nicht kommuniziert. Es entstand in der Öffentlichkeit unweigerlich ein schiefes Bild über die Berufsaussichten.
Gefährdet sind aber eigentlich nur Quereinsteiger, die ausschliesslich auf ein bestimmtes System spezialisiert sind und sich nicht genügend weitergebildet haben. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin selbst ein Quereinsteiger. Ich habe Mathematik studiert und nie einen Informatikabschluss gemacht, weil es den damals schlicht nicht gab.
Es bräuchte also eine riesige Imagekampagne, wie sie mit dem Jahr der Informatik 2008 geplant ist. Kann diese Kampagne, an der Sie auch beteiligt sind, das Ruder herumwerfen? Was erhoffen Sie sich?
Wir erhoffen uns in erster Linie, dass die Öffentlichkeit die Informatik und ihre Bedeutung so wahrnimmt, wie sie effektiv ist. Die Öffentlichkeit soll also erkennen, dass der Informatikberuf keine Zirkusnummer ist, sondern dass es in der Informatik auch in 20 Jahren vergleichbar viele qualifizierte Leute brauchen wird wie heute. Dabei ist ganz wichtig: Es werden nicht nur Akademiker und Top-Entwickler benötigt, sondern auch Leute mit anderen Aufgaben, auch im Support. Aber gerade diese müssen sich mehr Hintergrundwissen aneignen. Denn heute sind viele von ihnen Quereinsteiger ohne genügende Informatikausbildung. Beispielsweise haben während des Internethypes 17-Jährige ihre Gymnasialausbildung abgebrochen, Webseiten gestaltet und dafür sechsstellige Löhne kassiert. Aber heute fragt niemand mehr nach Leuten, die bloss Webseiten erstellen können. Hier verdeutlicht sich der Unterschied zwischen Produkt- und Konzeptwissen. Daher müssen wir vielen Quereinsteigern nachträglich ein theoretisches Fundament verpassen.
Das Jahr der Informatik soll aber auch die verfügbaren Ausbildungswege transparenter machen. So können Ausbildungsstätten aller Stufen öffentliche Veranstaltungen, die sie sowieso abhalten, als Teil dieser Kampagne verstehen und durchführen.
Damit hoffen wir auf einen Widerhall in der Bevölkerung. Gleichzeitig ist es Ziel des Jahrs der Informatik 2008, Missverständnisse und falsche Bilder über den Beruf des Informatikers, wie ich sie beschrieben habe, wieder gerade zu rücken. Ich weiss, wir haben mit der Fussballeuropameisterschaft keine geringe Konkurrenz beim Kampf um die öffentliche Aufmerksamkeit - aber wir haben ein Jahr Zeit.
Müsste auch generell mehr in Weiterbildung investiert werden?
Unbedingt. Nur: In der Schweiz haben wir eine schlechte Weiterbildungskultur. Ich postuliere bereits seit 30 Jahren: Jeder Informatiker und jede Informatikerin sollte mindestens zwei Wochen pro Jahr eine Weiterbildung besuchen, wovon eine Woche sich ausdrücklich dem Konzeptwissen widmen sollte. Das heisst, wir müssen die Firmen davon überzeugen, dass sie ihre Mitarbeiter mindestens eine Woche pro Jahr in Kurse schicken, in denen grundsätzliche Themen ohne direkten, aber nur kurzfristigen Nutzen zu ihrem aktuellen Job vermittelt werden.
Müsste nicht auch das ETH-Studium praxisnaher werden, damit mehr Studenten sich melden?
Nein. Das wäre falsch. Denn es braucht auch einen gewissen Anteil an Informatikern, die primär konzeptionell geschult wurden, Wissenschafter, Ingenieure und auch Lehrer, die die nächste Informatikergeneration ausbilden. Auf Fachhochschulebene ist die Anwendung viel näher und wird dort auch gepflegt.
Ein ganz anderes Thema ist aber die Informatikausbildung für «Nichtinformatiker», namentlich in den Gymnasien. Hier stehen zwar viele Computer, werden aber bloss angewendet und kaum verstanden. Viele Lehrkräfte sind eben selbst erst vor kurzem mit der Informatik in Berührung gekommen und können diese deshalb nicht so vermitteln, wie es nötig wäre. Wir haben es also mit dem klassischen Huhn-und-Ei-Problem zu tun.
Auch hier soll das Jahr der Informatik 2008 Impulse geben. So sind etwa die Hasler-Stiftung und die Universität Bern daran, ein Informatik-Lehrmittel für die Mittelschulen zusammenzustellen.
! KASTEN !